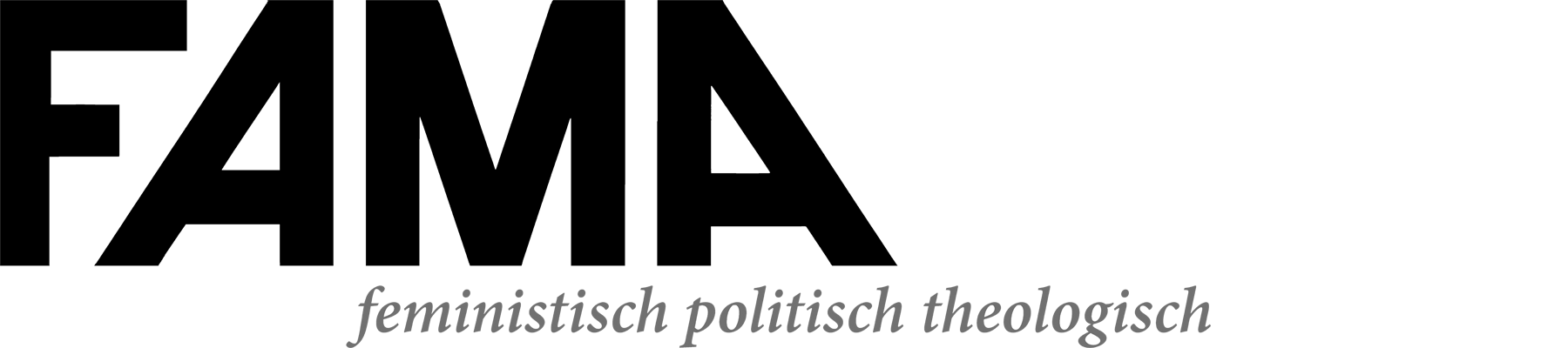Inhaltsübersicht
Silvia Strahm Bernet
Der Stuhl ist leer
Dorothee Dieterich
Eigentlich
Monika Hungerbühler
Ich habe dich beim Namen gerufen
Doris Strahm
… aber ich glaube daran
Ursula Vock
Den Mangel einbauen
Barbara Lehner
Jene Gegenwart, die ist
Li Hangartner
Gott
Jaqueline Sonego Mettner
SternMenschen
Barbara Seiler
Gott – nach Unbekannt verzogen
EDITORIAL
Im Sommer 1980, kurz vor unserem ersten Semester Theologie, ergatterte meine Freundin auf dem Flohmarkt ein Kreuzstichtuch, das während ihres ganzen Studiums über ihrem Bett hing. Rosenumkränzt prangte darauf der Satz: «Es können Menschen dich verlassen, jedoch dein Gott verlässt dich nicht. »
«Das ist es ja gerade», war der weniger kunstvolle Filzstift-Kommentar, der bald zwischen Spruch und Rosen stand. Das Tuch hat in meinen Augen dadurch gewonnen. Im Sommer 1980 kauften wir auch die ersten feministisch-theologischen Bücher. «Gott hat nicht nur starke Söhne» (1980) von Catharina Halkes. Und «Ein eigener Mensch werden» (1980) von Elisabeth Moltmann-Wendel. Und verschlangen und diskutierten sie mit ungeteilter Freude. Mary Dalys Buch «Jenseits von Gott Vater, Sohn und Co» (1980) konnte ich nicht einfach so, in der ganz gewöhnlichen Buchhandlung, kaufen. Dabei fürchtete ich nicht den Professor, der mir zufällig über die Schulter schauen könnte, sondern die Provokation; das Ungeheuerliche des Titels. Nachdem ich dann ein halbes Jahr täglich am Frauenbuchladen vorbeigegangen war, kaufte ich, das Buch dort. «Wenn Gott männlich ist, dann ist das Männliche Gott.» Dieser inzwischen viel zitierte Satz war die wichtige Erkenntnis daraus. Mary Daly machte uns die Verflochtenheit von Patriarchat und Gottesbild deutlich. Und weil diese Erkenntnisse uns halfen, uns selbst und unsere Situation zu verstehen, konnten wir nicht genug davon kriegen. So nahm die Furcht ab, nie Gehörtes zu lesen und Ungehöriges zu denken. In den folgenden Jahren gab es immer mehr feministisch-theologische Literatur. Die einerseits die männlichen Gottesbilder scharf analysierte und auf das dahinter stehende Herrschaftsinteresse befragte, andererseits aber auch hilfreich und lebendig war. Wie wohltuend war es, weibliche Gottesbilder in der Bibel aufzuspüren, (z.B. angeleitet von Virginia Mollenkott, «Gott eine Frau», 1984); wie spannend, in der Beschäftigung mit matriarchalen Religionen zu erkennen, dass der Trinität die drei Göttinnen vorausgingen (z.B. bei Heide Göttner-Abendroth, «Die Göttin und ihr Heros», 1980); und wie revolutionär, in der wöchentlichen Andacht «Gott» und «sie» zu sagen. Heute kommt mir die Erkenntnis, dass Gott genauso Göttin ist, sehr banal vor. Lese ich Aufsätze, die sich etwa mit weiblichen Gottesbildern in der Bibel beschäftigen, finde ich sie langweilig (meistens lese ich sie gar nicht). Matriarchale Spiritualität ist kein Stichwort mehr, schon gar kein provozierendes. Auch das Nachdenken über eine nicht sexistische liturgische Sprache hat die Faszination verloren – im Rahmen der Frauengottesdienste haben sich neue Formen von Liturgie entwickelt und das Literatürangebot dazu kann sich sehen lassen. Wir waren uns in der FAMA-Redaktion rasch einig über die Themen, um die es in diesem Heft nicht gehen soll. Dabei ist uns klar, dass wir auf die Erkenntnisse, die wir durch die Bearbeitung dieser Themen gewonnen haben, keinesfalls verzichten möchten. Nur: Was uns Anfang der 80er Jahre faszinierte und beschäftigte, ist keine Herausforderung mehr. Und das, obwohl sich in der «offiziellen» Theologie und der kirchlichen Praxis nur sehr wenig verändert hat. So läuft eine kaum vermeidliche Spaltung durch manche Theologin, für die auf der einen Seite Erkenntnisse der feministischen Theologie und die Praxis feministischer Spiritualität selbstverständlich geworden sind, die andererseits aber, sollte sie zufällig den Gottesdienst eines Kollegen besuchen, der alten sexistischen Sprache und den dazugehörigen Inhalten unverändert wiederbegegnen kann. Als katholische Theologin muss sie mit dieser unverträglichen Mischung wahrscheinlich innerhalb desselben Gottesdienstes fertigwerden. Und je nach Arbeitsort kann sie es auch kaum wagen, ihre religiöse Sprache im Gemeindegottesdienst zu gebrauchen. Und dass es keine katholischen Priesterinnen gibt, wird immer noch munter mit der Männlichkeit von Gottvater und Sohn begründet… Aber nicht um kirchliche Strukturen und Verbote soll es uns jetzt gehen, sondern um Gott. Das ist in gewisser Weise neu. In der FAMA zur feministischen Theologie (1/86) beschreibt Silvia Strahm Bernet deren Arbeitsfelder und Grundfragen. Als Grundthematik beschreibt sie dabei die Anthropologie: «das vielleicht entscheidende … Arbeitsfeld ist die Analyse der ‹Lehre vom Menschen›. » Dort fehlten bisher die Fragen der Frauen und nach den Frauen. Werden sie gestellt, führen sie «zu den feministischen Anfragen an das Reden von Gott». «So gibt es denn all diese Untersuchungen … zu den Überresten der Göttin in der jüdisch-christlichen Tradition, über den Zusammenhang von Männermacht und männlichem Gott, aber auch zu möglichen Alternativen dieses vereinseitigenden Redens.» Ausgangspunkt der Frage nach Gott ist dabei also nicht eigentlich die Frage nach Gott, sondern die Frage, wie von Gott gesprochen werden muss, damit Frauen von ihm/ihr her vollständiges Menschsein zugesprochen wird. Deutlich wird dies auch an den fettgedruckten Zitaten in derselben FAMA: «Was nützt uns ein Gott, dessen wichtigste Qualität nichts als das männliche Ideal repräsentiert, Macht zu haben, zu herrschen, zu bestimmen?» (D.Sölle) Diese Frage ist es, die zu der heftigen Diskussion über die Göttin und matriarchale Spiritualität (FAMA 3/85) führt. Bei der Lektüre fällt auf, dass sich die eindeutigen Verehrerinnen der Göttin keineswegs scheuen, direkte Aussagen über sie zu machen. Und von der Göttin wird dann direkt auf sich selbst zurückgeschlossen: «Stellen wir uns diese Dreiheit vor, die jede Frau zugleich hat, bekommen wir ein unglaubliches Spektrum an Fähigkeiten und Kräften … » (Heide Göttner-Abendroth, S. 5). Probleme der Institution und Tradition sind kein Thema: «Es gibt keine institutionelle Verankerung mit dogmatischer Glaubenslehre, dagegen Entfaltung freier Spiritualität.» (S. 4) Die Frauen dagegen, die von der befreiungstheologischen Perspektive herkommen, sind vorsichtig. Mit Rosemary Radfrod Ruether lehnen sie zwar «die Optik ab, die die eine Seite (die mütterliche, heidnische, natürliche) der anderen (der väterlichen, historischen, biblischen) vorzieht», bleiben aber in ihrem redlichen analytischen Denken immer zurückhaltend mit direkten Aussagen über Gott. Sie mühen sich durch sorgfältige Rekonstruktionen der eigenen Geschichte, suchen einen verantwortbaren Umgang mit ihrer Tradition. Der Vorschlag von Rosemary Radford Ruether, «Gott» nur noch historisch zu verwenden, ansonsten aber die unaussprechliche, und daher immer erklärungsbedürftige Vokabel «Gott/in» zu verwenden, macht vollmundige Aussagen ausserordentlich schwierig. In der liturgischen Sprache – die ein aussprechbares Wort braucht – werden andere Bilder und Namen verwendet. (Eine Vorgehensweise, die in ihrer Scheu an die Praxis der hebräischen Bibel erinnert.) Auch dabei gilt es achtsam zu sein: Wird der Vater im Himmel einfach durch die Mutter ersetzt, bleiben wir ewig Kinder. Und Theologinnen wie Dorothee Sölle machen auf die Notwendigkeit aufmerksam, Symbole zu finden, die nicht einseitig Transzendenz, sondern Verbundenheit ausdrücken: Wasser des Lebens, Licht, Tiefe… Dieser Bilder auflösende Prozess wird noch einmal verstärkt durch Carter Heywards Nachdenken, das in seiner Nähe zum tatsächlichen Leben vielen Theologinnen (und einzelnen Theologen) einleuchtet. Sie beschreibt Gott als «power in relation» – apersonal und jenseits aller vorstellbaren Bilder (C. Heyward, Und sie rührte sein Kleid an, 1986). Die Bilder, das Bild für die FAMA war darum als erstes klar: Es ist der leere Stuhl, der verlassene Thron (der wiederum dem leeren Thron des alten Gottes im Ersten Testament zum Verwechseln ähnlich sieht, nur seine Pracht eingebüsst hat). Über die Person (oder eben nicht Person), die den Stuhl verlassen hat, haben für einmal nur die FAMA-Redaktorinnen geschrieben. Der Fragehorizont hat sich verschoben: Wir blicken nicht mehr von unseren Defiziten her auf ein defizitäres Gottesbild und versuchen beide Defizite zugleich zu beheben. Sofern uns vollständiges Menschsein vorstellbar ist, gilt das inzwischen auch für Frauen. Auch wenn die gesellschaftliche Praxis noch nicht so weit ist: Welche von uns denkt von sich noch als von einem defizitären Wesen? Wir brauchen also keine himmlische Garantie für unsere Gleichwertigkeit. Die patriarchalen Gottesbilder sind als Kostüme entlarvt und wir haben – wenn wir Bilder brauchen – eine Vielzahl möglicher Bilder für Gott gefunden. Der Suchprozess der letzten Jahre hat uns auch gelehrt, dass es nichts gibt, das wir glauben müssen. Aber wie bringen wir diese Freiheit mit unseren frommen Herzen in Einklang – oder verzichten wir auf das fromme Herz? Wir waren in der Redaktion selbst erstaunt, wie schnell wir in eine intensive Diskussion verwickelt waren, nachdem wir die inzwischen «klassischen» feministisch-theologischen Fragen verlassen hatten. Es gab ein Suchen und Tasten nach neuen Fragen und Antworten. Es ging um eine feministische Glaubenspraxis, um den Wunsch, dass es Gott gibt. Um die Frage, wie sie in unserem Leben in Spiel kommt. Ist er das Loch, das es gäbe, wenn es ihn nicht mehr gäbe? Die leere Kammer in jedem Menschen oder das, was unser Leben offen hält? Verpassen wir die Beziehung zu ihr, wenn wir uns keine Zeit für sie nehmen? Brauchen wir ihn als Schutz gegen die Banalität des Lebens? Bald entdeckte jede die Stelle an der ihre Auseinandersetzung gerade läuft. Irgendwie läuft sie bei uns allen. Denn dass ist es ja gerade: Dein Gott verlässt dich nicht.
Dorothee Dieterich