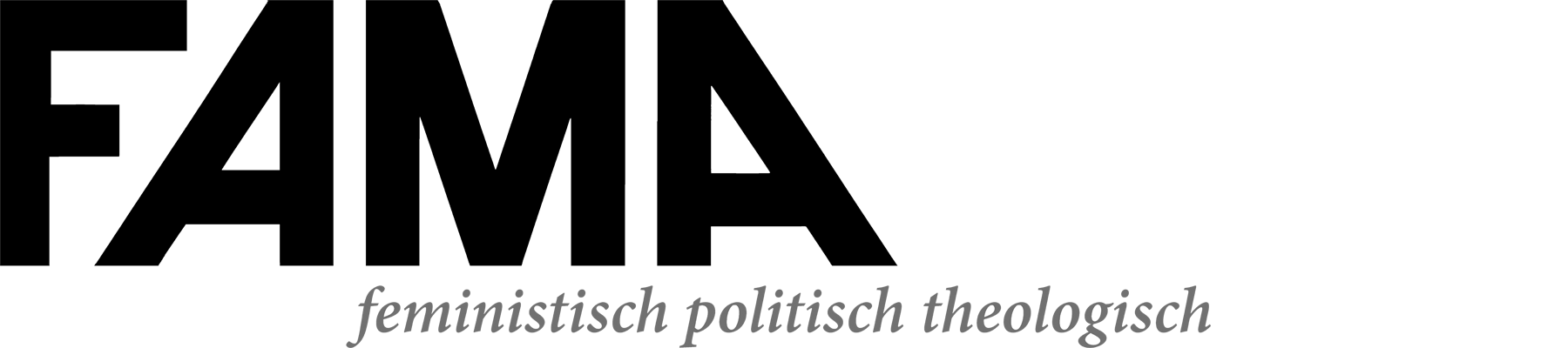Inhaltsübersicht
Elisabeth Mardorf
«Geht keinen anderen etwas an.»
Intimität und Geheimnis im Tagebuch.
Dorothee Dieterich
Hautlose Existenzen
Die Intimität von Müttern und Kindern
Helmute Conzetti-Weise
«Das durfte ich doch?»
Intimität in der seelsorgerlichen Praxis
Lisa Schmuckli
Nee, da ist nichts …
Oder: was ich nicht sehe, muss (m)ich berühren
Silvia Strahm Bernet
Das Auge Gottes
Simone Prodolliet
Nah und fern ist verschieden
Die kulturelle Geprägtheit von Intimität
Gisela Matthiae
Beziehungsweise …
Kritische Anmerkungen zu relationalen Gottesvorstellungen
Anna Gogl
Das Intime in der Pflege
Die Angst vor der Machtlosigkeit
EDITORIAL
Jacqueline Sonego Mettner
«Ein Zimmer für sich allein» forderte einst Virginia Woolf und pochte dabei auf die Notwendigkeit, Zeiten und Orte für das Bei sich Sein und die Musse zu haben. Ohne diese wäre es unmöglich, eine eigene Identität, eigene Bilder, eigene Worte für das Erleben und die Gefühle, das Denken und Nachdenken zu entwickeln. Der zur Verfügung stehende Raum für jeden Menschen in unsern Breitengraden hat sich vervielfacht. Zugenommen hat aber auch der Druck, alles möglichst schnell, zu erledigen. Die Zeiten, in denen die Menschen auf stundenlangen Fusswegen die grossen Entscheide ihres Lebens reifen liessen, sind vorbei. Zugenommen hat die Flut der Bilder und der Informationen, die ständig auf uns eindringen und das eigene Denken und die eigenen Vorstellungen zu okkupieren drohen. Zugenommen hat das Reden oder das Zerreden von Dingen, die früher intim, das heisst drinnen, verborgen geblieben sind und nur in dieser Verborgenheit überhaupt erlebbar waren. Immer schon bestand die Gefahr, dass in diesem Drinnen grosse Verletzungen zugefügt wurden. Es ist gut, dass darüber heute gesprochen wird und es keinen rechtsfreien Raum mehr gibt. Die Frage ist, wie viel und welche Art von Intimität brauchen wir heute?
Die Beiträge dieser FAMA stehen spannungsvoll zueinander: Intimität als Raum für das Wunder oder Intimität als Ort der Katastrophe? Intimität als Ort des Gesprächs mit mir selbst oder Intimität als Raum der Öffnung und Begegnung mit andern? Elisabeth Mardorf schildert die Segnungen des Tagebuchschreibens, das zu einer Vertrautheit mit sich selbst in allen Lebensphasen führt. Das Zimmer für sich allein wird mit den eigenen Möbeln ausgestattet, die Seele hat ein eigenes Gesicht und wird zum Felsen in der Brandung der öffentlichen Bilder und Ansprüche; wird gerade so zum Ausgangspunkt für intime Begegnungen mit andern. Intimität als Ort des Gesprächs mit sich selbst, dort wo Freiheit, Ungezwungenheit, Experimentierfreudigkeit, erlaubte Mangelhaftigkeit sein könnte, ist auch Thema der Glosse von Silvia Strahm Bernet. Versehen allerdings mit dem allgegenwärtigen Auge eines Vollkommenheit heischenden Gottes wird diese Intimität zum Kampfplatz, eine Arena, die auch in gottlosen Zeiten fortbesteht. Lisa Schmuckli verführt – ausgehend von der teilweisen Unsichtbarkeit des weiblichen Geschlechts – zu einer Kultivierung der weiblichen Identität und Intimität mittels einer Sprachfindung für das Ertasten und das Ertastete.
Intimität bedeutet Nähe, Unmittelbarkeit, Schutzlosigkeit, Eröffnung des Innersten, Ausgeliefertsein, Angewiesenheit. Dorothee Dietrich erzählt und reflektiert in berührend naher und kluger Weise die Intimität zwischen Müttern und Kindern. Die Hüllenlosigkeit des Neugeborenen, dessen grösste Kraft das Angewiesensein auf andere und das unbedingte Vertrauen in das Recht der eigenen Bedürfnisse ist, nimmt die Schutzhüllen der Mutter, die sie sich notwendigerweise beim Erwachsenwerden zugelegt hat, wieder weg. » Da haben wir gelernt, uns in einer Welt einzurichten, in der das Wunder wenig Platz hat, und müssen plötzlich mit ihm umgehen.» Und sie fragt, ob wir es nicht nötig hätten, auf eine erwachsene Art zu lernen, bewusst schutzlos zu sein?
Was sollen und können wir tun, damit die Situation der Abhängigkeit in der Pflege nicht zur Katastrophe wird? So fragt die Krankenschwester Anna Gogl. Menschen, deren Intimsphäre notwendigerweise in der Pflege tangiert wird, brauchen besonderen Schutz. Auch wenn sie sich enthüllen müssen, so haben sie doch Anspruch auf den Schutzmantel des Respekts, der unbedingten Wertschätzung, der Zuwendung durch Worte und genügend Zeit, der Freundlichkeit und Wahrhaftigkeit.
Die mit der Situation der einseitigen Abhängigkeit verbundenen Gefahren gibt es auch in der Seelsorge. Dass Menschen über ihre Gefühle und Ängste, ihre Wünsche und Hoffnungen sprechen, ist etwas Intimes und zugleich für die seelische Gesundheit Nötiges. Zugleich aber brauchen Rat suchende Menschen die Gewissheit, dass ihre Enthüllungen und ihre damit gezeigte Verletzlichkeit auf keine Art und Weise missbraucht wird. Davon schreibt Helmute Conzetti.
Was als intime Nähe empfunden wird und was nicht, wird kulturell unterschiedlich definiert. Simone Prodolliet erzählt von ihren Erfahrungen in Indonesien. Die Trennung der Frauen- und der Männerwelten rückt das gemeinsame Essen und Trinken von Mann und Frau in die Nähe einer nicht erlaubten Grenzüberschreitung, sieht hingegen im Schlafen auf einer Matratze eine Alltäglichkeit und unverdächtige Nähe zwischen Frauen.
Und wie ist es mit Gott und der Intimität? Es ist das Verdienst der Feministischen Theologie, die Wirkmächtigkeit Gottes in der Beziehung, im zwischenmenschlichen Geschehen, als eine diesseitige Macht unter und zwischen uns und nicht länger als eine jenseitige Macht über uns, entdeckt und beschrieben zu haben. In diesem Sinn ist Gott «intim», nahe, präsent im Innersten, wirklich im eigenen Tun und Lassen geworden. Gisela Matthiae würdigt und kritisiert dies. In dieser intimen Gottesvorstellung fehlt das kritische Potenzial eines Gegenübers. Wir laufen Gefahr, uns den Gott zu machen, der uns spiegelt und den nicht zu hören, der uns herausfordert und überrascht. Und es wird ein Druck erzeugt, in gelingenden und gerechten Beziehungen göttlich zu leben. Was aber wird mit den Unzulänglichkeiten, dem Versagen, der Schuld? Dem intimen Gott fehlt das Potenzial der Gnade. Eine Theologie, die ganz auf das Gottereignis in Beziehungen setzt, läuft Gefahr, überfordernd und damit unmenschlich zu werden.
Zu den Bildern: Das, was gemeinhin als intim angesehen wird, Schlafzimmer zum Beispiel, verliert das Intime, sobald es dem fotographischen Blick präsentiert wird. Mit den Bildern der Bildhauerin Hanna Villiger ist das anders. Jolanda Bucher und Eric Hattan sagen über sie und ihr Werk: «Während mehr als fünfzehn Jahren hat sie sich durch eine Kameralinse betrachtet, so die eigene Identität ertastet und diese in einem objektivierenden Medium, der Fotografie, als Skulptur reproduziert.» «Ein kleines Spiel zwischen dem ich und dem mir», sagt sie selber. Intime Bilder, Zeugnis einer unergründlichen Subjektivität.