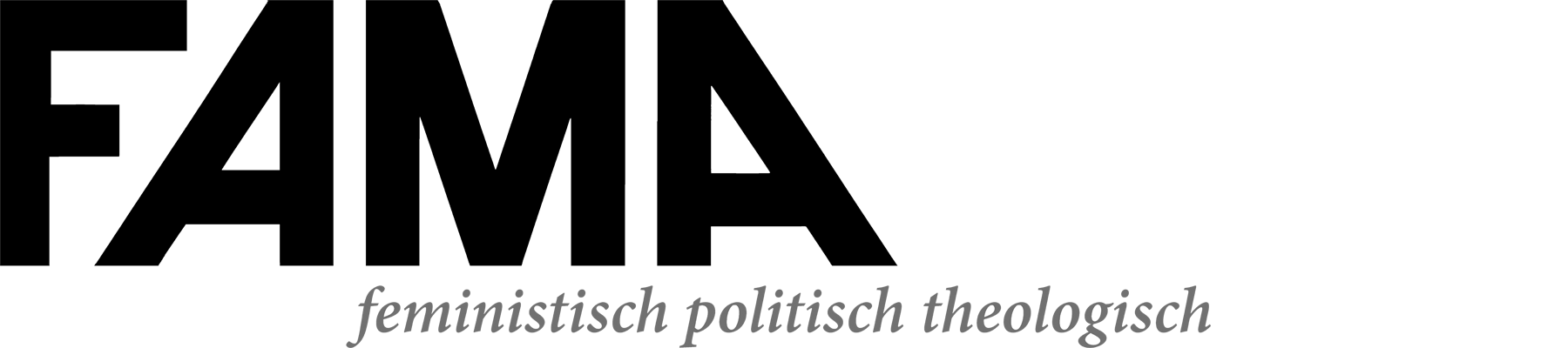Inhaltsübersicht
Menschen spielen, überall. Das Spielerische gehört zu uns. Spielerisch bauen wir andere Welten: Spiegelwelten oder Gegenwelten, Welten zum Aufklären oder zum Verklären, zum Aufstören oder zum Ablenken, zur Ermutigung und Hoffnung auch. Andrerseits gibt es Dinge, mit denen spielt man nicht; nicht ungestraft. Brot zum Beispiel, oder Liebe oder Wahrhaftigkeit oder Freundschaft; oder Gott. Da stünde zu viel auf dem Spiel. Von beidem ist in der neuesten FAMA die Rede: von der Leichtigkeit und Kraft des Spielerischen und von solchem, mit dem zu Spielen zynisch wäre.
Monika Hager
Spielregeln
Spiel und Regeln in Mathematik und Musik
Dorothee Dieterich
Verspielt
Heidi Schelbert-Syfrig
Marktwirtschaft als Spiel
verschiedene Poetinnen
«die welt hochwerfen»
Gedichte
Silvia Strahm Bernet
Der tanzende Christus
Gisela Matthiae
«Gott ins Spiel bringen»
Wer bestimmt die Spielregeln?
Claudia Schippert
Spielerisch Queer
EDITORIAL
Jacqueline Sonego Mettner
Meine älteste Tochter ist gutmütig. Sie passt schon einmal die Spielregeln den Bedürfnissen ihres knapp fünfjährigen Bruders an, wenn sie dadurch sein Verliergezeter verhindern kann. Anders ist da meine Zweite. Unerbittlich pocht sie auf die Einhaltung von Regeln. „Das muss er lernen.“ Sie hat eben ein Praktikum in einer Kinderkrippe absolviert und „weiss“ jetzt, wie Kinder zu erziehen sind. Ausserdem steht sie vor dem Beginn des Studiums der Rechte. Und drittens freut es sie immer noch diebisch, wenn sie gewinnt und der andere verliert. Sie war damals als Kleine die am heftigsten Tobende und Jubelnde beim Spielen. Mühsam hat sie sich in den Griff bekommen. Da soll es ihrem Bruder nicht besser gehen. Es ist jedes Mal neu faszinierend zu beobachten, welchen Weg ein Kind nimmt, mit dem Verlieren im Spiel umzugehen; was es alles braucht, bis Alternativen zum Heulen, Wegrennen, Türen schlagen, sich aufs Bett werfen, um sich schlagen und allen andern die Schuld geben, gefunden werden. Menschen spielen, überall. Menschen spielen verschieden (zeige mir wie du spielst, und ich zeige dir, wer du bist). Menschen spielen verschiedene Spiele. Den grössten Unterschied sehe ich zwischen den Spielen, in denen Regeln exerziert werden und Frau Fortuna das Zepter führt und solchen, in denen der Erfindungsgeist geweckt wird, angespornt und geleitet durch möglichst zuträgliche, die Spannung fördernde Spielregeln. Das Spielerische gehört zu uns. Spielerisch entwickeln wir andere Welten. Das fängt bei den Abenteuergeschichten der spielenden Stofftiere an, vielleicht oder wahrscheinlich auch bei den Games mit ihren virtuellen Welten, die gewiss nicht pauschal als gewaltfördernd und abstumpfend zu verurteilen sind, geht über das Theater, die Oper, den Film, die Literatur, die Musik. Spielerisch bauen wir andere Welten: Spiegelwelten oder Gegenwelten, Welten zum Aufklären oder zum Verklären, zum Aufstören oder zum Ablenken, zur Ermutigung und Hoffnung auch. Spielende Menschen bauen wie religiöse Menschen an andern Wirklichkeiten und sprechen der sogenannten „Realität“ ab, die einzig relevante Wirklichkeit zu sein. Es kommt dabei darauf an, was wir mit und im Spielerischen wollen. Diese Frage hat nichts mit Verzweckung des Spielerischen zu tun, sondern mit der Frage, was einem das Leben bedeutet und was man liebt. Andrerseits gibt es Dinge, mit denen spielt man nicht; nicht ungestraft. Brot zum Beispiel, oder Liebe oder Wahrhaftigkeit oder Freundschaft; oder Gott. Da stünde zu viel auf dem Spiel. „Mit dem Ernsten und Wichtigen spielen, verderbt den Menschen.“ sagt Goethe in seinen Schriften zur Literatur über den Dilettantismus. Aus diesem Grund ist der Beitrag der Ökonomin Heidi Schelbert zu Recht ein ernster, nicht spielerischer Beitrag. Die Frage nach Gerechtigkeit und nach der Einhaltung der elementarsten sozialen Menschenrechte darf nicht den heutigen Global players überlassen werden. Ihr „Spiel“ ist bitter ernst und im Grunde genommen ist bereits die Bezeichnung „Spiel“ für ihr Handeln zynisch angesichts der Menschen, die dabei verlieren. Denn diese Frauen, Kinder und Männer verlieren nicht ein Spiel, sondern ihr Leben, ihre Gesundheit, ihr Recht auf Bildung, auf Gehör, auf Beteiligung. Demütigend und schmerzlich ist es für sie, keinen Freiraum für das Spielerische in ihrem Leben zu haben. Die Theologin Gisela Matthiae schlägt in ihrem Beitrag Alarm. Auch sie spricht nur vordergründig vom „Spiel“ und vom „Spielfeld“ des Redens von Gott. Im Grunde geht es ihr um die Frage nach der Aufgabe der feministischen Theologie in einer Welt, in der die Religion in die Politik zurückgekehrt ist und vor allem in den USA in einem messianischen Nationalismus missbraucht wird wie in frühchristlichen Zeiten. „Argumentierten einst die Bürgerrechtler Martin Luther King oder auch John F. Kennedy christlich religiös, um marginalisierten Gruppen zu ihren Rechten zu verhelfen, so wird heute mit dem Verweis auf Gottes Weisung, Willen und Fügung versucht, nationale Aussenpolitik zu betreiben.“ Feministische Theologie hat die Unverfügbarkeit Gottes (und damit ihren Freiraum zum Spielerischen) zu schützen bzw. zu achten und muss dafür eintreten, dass Religion nicht zur Gefahr wird für eine offene Gesellschaft, für den Schutz der Menschen- und insbesondere der Frauenrechte. Dass man mit Brot nicht spielt, ist auch das Thema im Beitrag von Silvia Strahm Bernet. Bei ihr ist es der Gekreuzigte und sein Leiden, das nicht zum Spielen ist. Aber die Verwandlung des Gekreuzigten in einen Tanzenden bringt trotzdem etwas in Gang, eine Leichtigkeit, die dem Schweren trotzt und ihm – spielerisch – das Recht abspricht, die letzte Wirklichkeit zu sein. Beim Wort spielerisch assoziiere ich mühelos, leicht und denke dabei an Tänzerinnen oder Musiker, die gelöst und konzentriert zugleich Wunder vollbringen, fast ganz von selbst. Dabei weiss ich natürlich, wie viel Disziplin, wie viel Anstrengung hinter diesem Spielerischen stehen. Und ich weiss auch, dass Mathematik und Musik mehr miteinander zu tun haben, als gemeinhin angenommen wird. Wo die Berührungspunkte liegen und wo und wie das Regelwerk dann doch zum Spiel wird, voller Leichtigkeit, Spontanität und Kreativität, das verrät der Beitrag der Jazzmusikerin und Komponistin Monika Hager. Spielerisch und in ihrem Fall zeitweise verstörerisch leben mit der prozesshaften Identität als Frau. Claudia Schippert beschreibt die Queer Theorie am Beispiel ihrer eigenen Person. Mut, spielerischer und verspielter zu leben, macht der wunderbar leichte Beitrag von Dorothee Dieterich. Man möchte fast noch einmal von vorne anfangen mit dem Leben und alle Prüfungen so angehen wie sie es gemacht hat. Und Karten spielen mit ihr wäre auch nicht schlecht. Oder Gedichte lesen. Als Erstes jene in der Mitte dieser FAMA, spielerisch, verspielt, das Schwere hochwerfend, neu zugemutet.